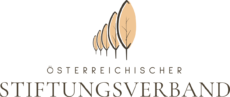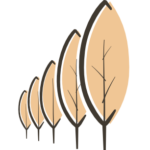Forum „Zukunft Stiftung“ – Nachbericht
Am 15. Oktober fand im K47 die Auftaktveranstaltung von „ZUKUNFT STIFTUNG“ statt und war ein voller Erfolg. Es war ein Abend voller spannender Impulse, lebendiger Gespräche und inspirierender Begegnungen. Ein besonderes Highlight bildete zweifellos der Beitrag des Zukunftsforschers Tristan Horx. In seiner unverwechselbaren Art gelang es ihm, die Unterschiede zwischen den Generationen mit Leichtigkeit und Humor zu erklären – und