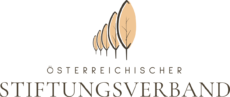Das Stiftungswesen
STIFTUNGEN – EIN RECHTSINSTITUT MIT GESCHICHTE
ÖStV argumentiert in seiner Stellungnahme gegen eine Erhöhung der Stiftungseingangssteuer.
ÖStV übermittelt eine Stellungnahme zum Nachhaltigkeitsberichtsgesetz .
Stellungnahme des ÖStV zum FM-GwG-Anpassungsgesetz mit dem Vorschlag, statt der Einsicht/Übermittlung der Stiftungszusatzurkunde einen entsprechenden Aktenvermerk („legal opinion“) gesetzlich vorzusehen.
Stellungnahme des ÖStV als massiver Widerstand gegen die Bemühungen zur geplanten Veröffentlichung der Stiftungszusatzurkunde.
- Nach Abstimmung mit seinen Mitgliedern übermittelt der ÖStV eine überarbeitete Stellungnahme ua mit dem Vorschlag , die Verpflichtung zur Durchführung einer jährlichen Bestätigungsmeldung bei keiner Änderung der inhaltlichen Daten abzuschaffen, um dadurch unnötigen bürokratischen Aufwand zu reduzieren.
- Das BMF übermittelt einen Entwurf der Neufassung des Erlasses zum Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) und lädt den ÖStV zur Übermittlung einer Stellungnahme ein.
Breite Verteilung des Imagefilms „Privatstiftungen – Kraft der Vielfalt“ über Youtube in Österreich.
Festsymposion „30 Jahre Privatstiftung in Österreich“ (Kooperation BMJ, Institut für Unternehmensrecht (WU) und ÖStV) im Palais Trautson und Erstaufführung des Imagefilms „Privatstiftungen – Kraft der Vielfalt“.
- 2023: knapp 3.000 aktive Privatstiftungen (vgl nur zirka 1200 AG nach 170 Jahren) verankern Vermögen nachhaltig für unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft
- rund jedes zehnte „Horizon 2020“-Projekt in Ö weist einen Bezug zu einem verstifteten Unternehmen auf
- Zehn der Top 30 Patentanmelder und fünf der Top 30 Markenanmelder in Ö sind Stiftungsunternehmen
- Seit 1993 über 4.000 Privatstiftungen gegründet
- zirka 11.000 Beteiligungsunternehmen, darunter bedeutende Familienunternehmen und privat geführte Unternehmen
- sind anerkannt als bester Schutz gegen ausländische Übernahmen (bspw in Krise 2008 – 2010)
- tragen innovativ den technischen Fortschritt und grünen Wandel
- sind Trägerinnen und Partnerinnen bedeutender Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen
- als Mitarbeiterstiftungen beteiligen sie Mitarbeiter:innen am Unternehmenserfolg
Juni 2022: Übergabe eines moderaten, bedarfsgerechte Reformentwurfs des ÖStV zum PSG an BM Dr. Zadić
Verbesserung von drei Regelungen im Zivilrecht (PSG):
- Die Beseitigung der Versteinerung der Privatstiftung (Änderungsrecht)
- Die gesetzliche Verankerung der von 1993 bis 2009 bewährten privatautonomen Gestaltung der Governance der Privatstiftung (familienbesetzter Stiftungsbeirat)
- Regelung zu Insichgeschäften der Mitglieder des Stiftungsvorstands zur Entlastung der Firmenbuchgerichte
- 2021 – 2022: Zahlreiche Veranstaltungen und Treffen mit namhaften Expert:innen und Ansprechpartner:innen zu Grundlagen und konkreten Reformvorschlagen
- 2020: Start ÖStV-Expert:innengruppe mit Arbeiten für Novellierung des PSG gemeinsam mit Mitgliedern, breiter wissenschaftlicher Expertise und Erfahrungen aus der Beratung.
- Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung 2020 – 2024: „Aus Verantwortung für Österreich“ sieht die „Reform und Attraktivierung des Privatstiftungsrechts im internationalen Vergleich unter Stärkung der Begünstigtenstellung“ als zivil- und wirtschaftsrechtliches Vorhaben explizit vor (Regierungsprogramm-2020-2024.pdf)
Erweiterung der satzungsgemäßen Aktivitäten auf gesamtes Stiftungswesen – „Verband Österreichischer Privatstiftungen (VÖP)“ wird zum „Österreichischer Stiftungsverband (ÖStV)“:
- Unternehmensträger- und Familienstiftungen
- Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen
- Forschungsförderungsstiftungen
- Kulturträgerstiftungen sowie
- Stiftungen mit gemeinnützigen Zwecken
Der ÖStV ist das Forum für den Austausch über aktuelle rechtliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, laufende Erhebung relevanter Daten und Kooperationen mit Verbänden.
Konkrete Darstellung des positiven Wirkens des Stiftungswesens für unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft.
- Erneute Darlegung des bestehenden Reformbedarfs gegebenüber Ministerien
- Finanzfrühstück zum Thema Stiftungen im BMF (sog. „Löger-Frühstück“ am 11.06.): BM Mag. Löger lädt zirka 30 Persönlichkeiten aus dem Stiftungswesen, darunter namhafte Wissenschaftler:innen, Stifter:innen, Stiftungsvorstände und Expert:innen aus der Beratung zum Meinungsaustausch ins BMF.
Ziel: im demokratischen Prozess notwendige Maßnahmen zu erkennen, um die Rahmenbedingungen für Privatstiftungen und deren Wirkungskraft in Österreich zu verbessern.
- Novelle zum PSG wird nicht beschlossen
- Begutachtungsverfahren: zum PSG-Gesetzesvorhaben (Ministerialentwurf BMJ)
- Innerhalb der Begutachtungsfrist: 33 Stellungnahmen, die in wesentlichen Punkten mit teilweise scharfer Kritik übereinstimmen; einzig die Stellungnahme der AK fällt positiv aus.
- Stellungnahme des VÖP zum Begutachtungsentwurf
- Ministerialentwurf wird vom BMJ vor der parlamentarischen Behandlung zurückgezogen.
- Ohne Begutachtungsverfahren übermittelt das BMJ einen Ministerialentwurf einer PSG-Novelle dem Nationalrat, der zum Teil von Ergebnissen aus der Arbeitsgruppe abweicht.
- Darlegung des bestehenden Reformbedarfs gegenüber Ministerien in unterschiedlich besetzten Runden
- Zahlreiche Gesprächs- und Arbeitsrunden in einem Arbeitskreis im BMJ unter Beiziehung von Expert:innen einschließlich Vertreter:innen des VÖP sowie Repräsentant:innen von Interessenvertretungen (AK, IV)
- 2015: VÖP startet neue Offensive für eine PSG-Novelle
Verhinderung (der 1993 nicht geplanten) systemwidrigen Veröffentlichungspflicht von Konzernabschlüssen im Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 durch den VÖP
Es bleibt bei der – völlig ausreichenden – öffentlichen Rechnungslegung aller Beteiligungsunternehmen der Privatstiftung, auch dank der Bemühungen des VÖP (Stellungnahme des VÖP zum Begutachtungsentwurf)
VÖP verstärkt seine Bemühungen zur Reform des PSG:
- ausgelöst durch die Rechtsprechung und die Untätigkeit der Politik wächst die Enttäuschung in der Stiftungslandschaft
- Abwanderung und Auflösungen von Stiftungen
- VÖP führt dazu Gespräche mit Mitgliedern der Regierung
- Pflicht zur Offenlegung der Begünstigten beim BMF (§ 5 PSG)
- Abberufung von Mitgliedern des Stiftungsvorstands (§ 14 Abs 3 und Abs 4 PSG)
- Berücksichtigung von Lebensgefährten (§ 15 Abs 2 PSG)
- Berater, die die Interessen eines Begünstigten vertreten, unterliegen der Unvereinbarkeit im Stiftungsvorstand (§ 15 Abs 3a PSG)
Die geforderte Klarstellung der Kontrollrechte eines begünstigtenbesetzten Beirats unterbleibt!
Zu diesem Zeitpunkt bestehen 3.313 aktive Privatstiftungen: Höchststand
OGH – Beiratsentscheidung I + II
Unvereinbarkeitsbestimmungen des § 15 Abs 2 und Abs 3 PSG gelten auch für Vertreter:innen eines Begünstigten
ein fakultativ eingeführter Beirat, dem bestimmte Kompetenzen zukommen (Zustimmungs-, Mitwirkungs-, Weisungs-, Bestellungs-, Abberufungsrechte) kann nicht mehrheitlich mit Begünstigten besetzt werden.
Hintergrund: Die unerwarteten Änderungen durch diese Rechtsprechung nach 16 Jahren PSG (!), die bis heute vom Gesetzgeber nicht repariert wurden, führen zu Abwanderung und Auflösung von Stiftungen – was der ursprünglichen Idee bei Schaffung des Privatstiftungsgesetzes diametral entgegensteht.
Der historische Gesetzgeber sah im PSG im internationalen Vergleich zur Vermeidung von Interessenskonflikten äußerst strenge Regeln zur Zusammensetzung des Stiftungsvorstands vor. Im Gegenzug sollten Stifter:innen bei der Regelung der Zusammensetzung weiterer Organe eine hohe privatautonome Gestaltungsfreiheit haben, in jedem Fall den begünstigten Mitgliedern der Stifterfamilie Kontrollrechte als Mitglieder eines fakultativ eingerichteten Beirats einräumen können – was die meisten Stifter:innen gemacht haben. Diese Gestaltungsfreiheit wird – entgegen den positiven Erfahrungen aus 16 Jahren – durch die Beiratsentscheidung I + II verunmöglicht.
Völlig klar: Praxis und Rechtsprechung brauchen entsprechende klare gesetzliche Regelung = Reform des PSG
Beachtlich: der durch die Rsp entstandene Bedarf der Anpassung der Stiftungsurkunde kann im Einzelfall mangels Änderungsrecht gar nicht vollzogen werden – und trotzdem bleibt die Politik (im Rechtsstaat!) untätig.
VÖP übermittelt Positionspapier an Bundeskanzleramt
BK Dr. Schüssel ist Teilnehmer einer Veranstaltung des VÖP, der ihm in der Folge ein Positionspapier übermittelt.
Arbeiten an Änderungen einzelner Bestimmungen des PSG
Der Fachsenat für Stiftungsrecht der Rechtsanwaltskammer Wien arbeitet an einem Entwurf zur Änderung der Regelungen über die Besetzung eines freiwilligen Organs (Beirat).
Ziel ist die Klarstellung, dass die Bestimmungen über einen gesetzlichen Aufsichtsrat nicht sinngemäß anzuwenden sind, sodass ein Beirat auch ausschließlich mit Begünstigten oder nahen Verwandten besetzt werden darf.
Art XI ME des Kapitalmarktoffensiv-Gesetz (KMOG; 115/ME 21.GP)
Unvereinbarkeitsregelungen für Stiftungsvortand und Aufsichtsrat sollen abgeschwächt und Zweifelsfragen für Besetzung von Beiräten beseitigt werden; der Entwurf wird leider nicht Gesetz
- 1 Mio Schilling werden in 70.000 Euro Mindestkapital umgewandelt (§ 4 PSG)
- Gewöhnlicher Aufenthalt in EU oder EWR genügt fortan bei Stiftungsvorstandsmitgliedern (vormals gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich; § 15 Abs 1 PSG)
Der Verband Österreichischer Privatstiftungen (VÖP) setzt sich in Wertschätzung der Menschen in unserem Land für die Interessen von Stiftungen, Stifter:innen und daran beteiligten Personen ein.
Der Verband hat sich dem Ziel verschrieben, offensiv auf den begründeten Reformbedarf im Stiftungsrecht hinzuweisen und konkrete Regelungen vorzuschlagen.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und auf dem Weg Österreichs in die EU überzeugen BK Dr. Vranitzky (SPÖ) und BM Lacina (SPÖ) alle Parlamentsfraktionen von den Vorteilen der Privatstiftung als neue Rechtsinstitution.
- 13.01.1993: Ministerialentwurf
- 16.06.1993: Regierungsvorlage
- 01.07.1993: Justizausschuss
- 22.09.1993: Beschluss des Nationalrats
- 01.09.1993: Inkrafttreten des PSG
- 4 Privatstiftungen werden noch 1993 gegründet
Das Bundesgesetz über Privatstiftungen (Privatstiftungsgesetz–PSG) wird von allen Parlamentsfraktionen einstimmig beschlossen, inklusive steuerrechtlichen Maßnahmen mit dem Ziel, wertschöpfendes Vermögen in Österreich zu erhalten und für ausländische Stifter:innen Österreich als Stiftungsstandort attraktiv zu machen.
Die Stifter:innen überzeugte vor allem die hohe Privatautonomie und weitere Einwirkungsmöglichkeit bei der Gründung und Gestaltung ihrer Privatstiftung.
Wissenschaftliche und praktische Vorarbeiten über die Notwendigkeit und Grundlinien der Gestaltung einer Unternehmensstiftung für Österreich.
Die wichtigsten Fragen
Was ist eine Privatstiftung?
Wie funktioniert eine Privatstiftung?
Warum bedarf das Privatstiftungsgesetz (PSG) einer Reform?
Eine Privatstiftung ist eine Rechtsform, die durch eine Stiftungserklärung, einen Notariatsakt und eine Firmenbucheintragung entsteht. Sie ist eine juristische Person ohne Eigentümer und verfügt über ein Vermögen, welches vom Stifter oder der Stifterin eingebracht wird. Bestandteil der Stiftungserklärung ist auch immer der Stiftungszweck, in dessen Sinne das Vermögen genutzt, verwaltet oder auch verwertet wird.
Der Privatstiftung liegt nämlich der Gedanke zugrunde, dass mit einem „eigentümerlosen“ Vermögen ein bestimmter Zweck besser, zielstrebiger und auch dauerhafter verwirklicht werden kann, als wenn das Vermögen mit dem Schicksal des Stifters oder der Stifterin und dem der Rechtsnachfolgen verbunden bliebe und etwa in eine Gesellschaft eingebracht würde, die von den Gesellschaftern und Gesellschafterinnen beeinflussbar ist. Mit der Errichtung einer Privatstiftung kann eine auf Grund der Erbfolge drohende Zersplitterung und Teilung von Familienunternehmen verhindert werden. Es kann sichergestellt werden, dass das Lebenswerk des Stifters oder der Stifterin auch über den Tod hinaus erhalten bleibt und im gewünschten Sinn verwaltet wird.
Da es eine Vielzahl von Stiftungen mit sehr unterschiedlichen Stiftungszwecken gibt, kann diese Frage nicht einheitlich beantwortet werden. Damit eine Privatstiftung funktioniert, also ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen kann und im Sinne des Stiftungszwecks agieren kann, braucht es aber eine Reihe von Organen. Unbedingt notwendig sind Stiftungsvorstand, Stiftungsprüfer und gegebenenfalls ein Aufsichtsrat.
Das Privatstiftungsgesetz ist ein noch relativ junges Gesetz aus dem Jahr 1993. Nach knapp 30 Jahren ist nun ein guter Zeitpunkt, die gemachten Erfahrungen einzusetzen und Verbesserungen durchzuführen. Denn: Geschriebenes Stiftungsrecht und gelebtes Stiftungswesen stehen teilweise im Widerspruch.
Nach ersten Generationswechseln sowie erster Erfahrung mit Alter und Krankheit stiftungsrelevanter Betroffener und den Folgen der Versteinerung der Privatstiftung zeigt sich in Teilen die Notwendigkeit einer Anpassung ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei geht es in erster Linie um mehr unternehmerische Flexibilität.
Die größten Vorurteile
Die Privatstiftung ist eine komplexe Rechtsform und mit vielen Mythen und Vorurteilen behaftet. Finden Sie heraus, was hinter diesen Aussagen steckt.
Stiftung als Steuerschlupfloch: Stimmt nicht!
Stiftungen nützen nur den Begünstigten und das Geld ist eingefroren: Zu kurz gedacht
Stiftungen sind intransparent: Im Gegenteil!
Steuerliche Anreize, die es ursprünglich für die Übertragung von Eigentum auf Stiftungen gab, sind sukzessive weggefallen. Einzig verblieb die Möglichkeit der Übertragung von bei einer Veräußerung aufgedeckten stillen Reserven auf eine neu angeschaffte Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft.
Da rund 2/3 der Privatstiftungen direkte oder indirekte Beteiligungen an Unternehmen halten, nützen Privatstiftungen letztlich allen: dem Arbeitsmarkt, dem Allgemeinwohl, der Volkswirtschaft. Aufgrund der Vielfalt der bestehenden Privatstiftungen werden zahlreiche weitere Impulse gesetzt: (Produkt-)Innovationen, Klimaschutz, Digitalisierung. Damit ist das in einer Privatstiftung liegende Kapital nicht starr eingefroren, sondern wird dynamisch und dem Zweck entsprechend eingesetzt. Verlässlich verbleiben aber Werte, Firmensitze und Innovationsstandorte in Österreich.
Privatstiftungen sind weder in Bezug auf ihre Berechtigten noch auf ihre unternehmerischen Vermögenswerte intransparent. Die Transparenz ist zurecht gesetzlich verankert. Durch das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) wurden auch Stiftungen verpflichtet, Daten zu ihren „wirtschaftlichen Eigentümern“ (u.a. Stifter und Stifterinnen, Begünstigte, Stiftungsvorstand) zu melden, die jeder einsehen kann. Österreich ist hier im internationalen Vergleich an vorderster Front.
Eine Reihe weiterer Vorschriften sichert das Prinzip der gläsernen Stiftung: Sie unterliegen dem Körperschaftssteuergesetz, müssen dem Finanzamt gemeldet werden, dort auch die wichtigsten Dokumente einreichen und sie sind ausnahmslos im Firmenbuch einzutragen. Dort sind übrigens auch alle Daten über die Beteiligungen von Privatstiftungen zu finden, da es sich in der Regel um Kapitalgesellschaften mit hohen Anforderungen an die Transparenz handelt.